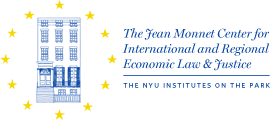
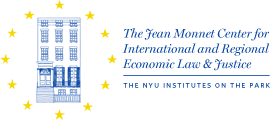 |
Die heue so verbreitete Meinung, Europa sei kein Staat, aber es brauche eine Verfassung, ist neueren Datums allenfalls insofern, als im Begriff der Verfassung der einer demokratischen Legitimation mitgedacht wird - einem Maßstab, den sich auch das Weißbuch zu eigen macht, wenn es auf das ,,zweifache demokratische Mandat der Union verweist (S. 9), um dann die ,,Grundsätze des guten Regierens“ als demokratisch-rechtsstaatliche Prinzipen vorzustellen, die in allen Regierungsebenen stärker zur Geltung kommen sollen (S. 13).
Das als Demokratiedefizit bezeichnete Legitimationsproblem hat indessen die Rechtswissenschaft gleichsam von Anfang an beschäftigt. Sie hat hierauf nur anders reagiert, als dies in der gegenwärtigen Debatte weithin üblich ist: Sie hat - wenngleich vielfach in der verschlüsselt-doktrinellen Weise der Jurisprudenz und ohne sich um die Übersetzung ihrer Begriffe in die Kategorien und Fragestellungen anderer Disziplinen oder öffentlicher Diskurse zu kümmern - für eine Institutionalisierung von Rationalitätskriterien plädiert,7 die ein transnationales ,,Regieren“ rechtfertigen können, das den Maßstäben der nationalstaatlich organisierten Verfassungsstaaten nicht genügen mag, mit ihnen aber dennoch verträglich ist. ,,Europa hat sich eine Verfassung gegeben, die ein von dem Muster nationalstaatlicher Demokratien grundsätzlich abweichendes Legitimitätsmuster institutionaliseren mußte“ - für diese Antwort gibt es der deutschen Rechtstradition Begründungen, die sich geschichtlich zumindest bis in die Weimarer Republik zurückverfolgen lassen. An sie konnte das deutsche Europarecht anknüpfen, als es sehr früh und in einer unbelasteten Tradition so nicht zu erwartenden konzeptionellen Stringenz auf die Frage reagierte, wie Europa als eine über dem Recht der Mitgliedstaaten stehender ,,Herrschaftsverband" möglich sei. Diese Begründungen waren uneinheitlich - und sind gerade wegen ihrer Differenzen aufschlußreich. Drei kommen im Titel dieses Essays zur Sprache; zwei von ihnen - der Ordoliberalismus und der Funktionalismus - sind wirkliche Markenzeichen der deutschen Europarechtswissenschaft geworden; eine dritte hatte sich diskreditiert - auch dies sollte man wissen und nicht vergessen.
Im Rahmen seiner Studien zur Privatrechtsgeschichte hat Knut Wolfgang Nörr8 zwei Konzepte in der (deutschen) Wirtschaftsrechtsgeschichte identifiziert. Bei beiden handelt es sich in aktuelleren Sprechweise um deutsche varieties of capitalism ,,organisierte Wirtschaft“ nennt Nörr die eine, ,,sozialen Marktwirtschaft“ heißt die andere Variante. Die ,,organisierte Wirtschaft“ sieht Nörr als eine Erblast aus der Weimarer Republik, freilich eine, deren Vorläufer in der Epoche des in ,,organisierten Kapitalismus“ des 19. Jahrhunderts zu finden seien. Die zweite Variante, die ,,soziale Marktwirtschaft“, repräsentiert für Nörr die bessere Tradition. Ihren ordnungspolitischen Kern bildet der Ordoliberalismus. Diese Konzeption haben in der Nationalökonomie vor allem Walter Eucken, Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke kongenial mit dem Juristen Franz Böhm, am Ende 20er Jahre entwickelt - angesichts und gleichsam auf dem Höhepunkt der wirtschafts- und verfassungspolitischen Krise der Weimarer Republik. In diesem Kontext entstand die ordoliberale Forderung nach einem ,,starken“ Staat, der eine dem Wirtschaftsgeschehen immanente, freilich schutzbedürftige, ordo ohne politische Rücksichtnahmen durchsetzen sollte.9 Hermann Heller hat - noch vor der nationalsozialistischen Machtergreifung den ordoliberalen als ,,autoritären“ Liberalismus kritisiert.10 Diese Qualifikation traf die ordoliberale Kritik an einem Pluralismus, in dem der Interessenkampf den Inhalt der staatlichen Politik bestimmt. Dies war freilich nicht der ,,starken Staat“, den Carl Schmitt in seiner Rede von 1932 als Garanten einer ,,gesunden Wirtschaft“ vorstellte,11 und den dann der Nationalsozialismus in Szene setzte. In diesem starken Staat galt der Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft - und dessen Exponenten kam der Gedanke einer ordnungspolitischen Bindung der Politik nicht in den Sinn.
Eben dieser Kerngedanke war es denn auch, den der Ordoliberalismus in der formativen Phase zunächst der Bundesrepublik und dann der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Geltung brachte. Im Innern wurde der politischen Verfassung die Wirtschaftsverfassung an die Seite gestellt, um so die Marktwirtschaft gegen diskretionäre politische Zugriffe abzuschirmen.12 Der ordoliberale Theorie der Wirtschaftsverfassung beantwortete gleichzeitig die Frage nach der Legitimität europäischen ,,Regierens“: Sie verstand die im EWGV verbürgten Freiheiten, die Öffnung der Volkswirtschaften, die Diskriminierungsverbote und Wettbewerbsregeln als gemeinschaftliche Grundsatz-Entscheidung für eine marktwirtschaftlichen Ordnung zu deuten.13 Und gerade der Umstand, daß Europa als bloße Wirtschaftsgemeinschaft auf den Weg gebracht worden war, verlieh der ordoliberalen Argumentation Plausibilität: Mit der Deutung der wirtschaftsrechtlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft als einer auf Recht gegründeten und auf die Sicherung wirtschaftlicher Freiheiten verpflichteten Ordnung, gewann die Gemeinschaft eine eigene, von den Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates unabhängige Legitimität, aus der sich zugleich Schranken für die Gestaltung dieser Gemeinschaft ergaben.
Die ordoliberale Theorie hat einen faktisch-normativen Doppelstatus. Ihre Aussagen über die Ordnungsmuster der Wirtschaft, bezeichnen wirtschaftliche Abläufe, institutionelle Vorstellungen, wirtschaftpolitische Programmatiken; ihre Wohlfahrtsversprechen ,,gelten“ empirisch, wenn institutionelle Rahmen ,,gilt“, den die Ordnungstheorie postuliert. Deshalb ist der Ordoliberalismus durch eine politische Praxis, die seinen Vorstellungen nicht entspricht, kaum in Verlegenheit zu bringen. So eindeutig ist das Verhaltnios von Theorie und Praxis aber ohnehin nicht. Die deutsche Politik hat den Leitbildern, Konzeptionen, Institutionalisierungen im ordoliberalen Sinne immer wieder ihre Reverenz erwiesen; sie hat andererseits eine ordnungspolitische Indifferenz an den Tag gelegt, die ein Paktieren mit der “organisierten Wirtschaft“ einschloß.14 Und sie konnte sich darauf berufen, daß der Ordoliberalismus im Staats-, Verfassungs-, Verwaltungsrecht nur sehr verhalten unterstützt wurde - dort bestimmte die wirtschaftspolitische Gestaltungsfreiheit des demokratisch beglaubigten Gesetzgebers über die ,,Verfassung“ der Wirtschaft. Nörr bezeichnet deshalb ,,als ein Grundphänomen in der Entstehungsgeschichte der Bonner Republik... [ihre] wirtschaftspolitische und wirtschaftsverfassungsrechtliche Zweigleisigkeit“; ...und ,,für die Wirtschaftsordnung, die den neuen Staat prägen sollte, müssen wir geradezu von einer doppelten Inszenierung sprechen, von zwei Aufführungen desselben dramatischen Stückes, die voneinander keine Notiz nahmen.“15 Die Weigerung des Bundesverfassungsgerichts, dem Grundgesetz eine rechtlich bindende Wirtschaftserfassung zuzuschreiben,16 belegt dies Nörr zufolge17 am nachdrücklichsten.
Die Institutionalisierung beider Rationalitätsmuster nebeneinander, des ordungspolitischen wie des politisch-diskretionären, ließ sich theoretisch nicht auflösen; praktisch-politisch war jener ,,Gegensatz und Widerspruch“,18 das belegt die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der jungen Bundesrepublik, ohne weiteres aushaltbar.
Mit dem Projekt der Integration Europas aber entstand eine neue Lage. Der Ordoliberalismus kam, weil seine Theorie der Wirtschaftsverfassung diese gerade dem parlamentarisch-majoritären Zugriff entziehen sollte, mit den Suprematieansprüchen des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich ohne weiteres zu Recht - jedenfalls, wenn und soweit dieses sich an der Programmatik der Herstellung eines ,,Systems unverfälschten Wettbewerbs“ orientierte. Demgegenüber stellten die Diskrepanzen zwischen den Prinzipien der parlamentarischen Demokratie und den so nicht legitimierten Befugnissen der Gemeinschaft für die ,,zweite Tradition“ ein Problem dar, dessen Lösung eine alternative Legitimation und Beschränkung europäischer Gestaltungsansprüche verlangte.
Solche Alternativen fanden sich. Und wie im Falle des Ordoliberalismus reichen ihre Begründungen in die Zeit der Weimarer Republik zurück. Unter dem Eindruck einer schon damals als rasant erscheinenden technischen Entwicklung und Verwissenschaftlichung formiert sich in Deutschland eine überwiegend konservative Kulturkritik,19 in den USA und anderswo eher zuversichtlich gestimmte technokratische Politikkonzepte.20 In den 60er Jahren erlebten diese Vorstellungen ihre Renaissance. Im deutschen Verfassungsrecht ist hier vor allem an Ernst Forsthoff zu erinnern. Er diagnostizierte in seinem ,,Staat der Industriegesellschaft“ ein die förmliche Verfassung überlagerndes, ihr existentiell überlegenes Herrschaftssystem.21 Neben der schon lange - seit 1938 in Übernahme des von Karls Jaspers geprägten Begriffs - fest etablierten ,,sozialen Realisation“ (,,Daseinsvorsorge“) kämen Zwänge einer ,,technischen Realisation“ zur Geltung, die, wie es in einem Begleitaufsatz hieß, “dem freiheitlichen Staat eine partielle Identifizierung mit der Technik durch die Bedingungen des technischen Prozesses“ aufgenötigten.22 Es gebe einen ,,inneren Kreis, in dem das Sachwissen herrscht und die sachgerechten Entscheidungen getroffen werden“.23 Kongenial erklärte Helmut Schelsky: “An die Stelle der politischen Normen und Gesetze [treten] Sachgesetzlichkeiten der wissenschaftlich-technischen Zivilisation..., die nicht als politische Entscheidung setzbar und als Gesinnungs- und Weltanschauungsnormen nicht verstehbar sind“.24
Die sogenannte Technokratie-Debatte, in deren Kontext diese Aussagen gehören, hat der Europäischen Gemeinschaft wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Aber sie bot sich als Beleg für die Emergenz einer technokratischen Herrschaft an.25 In Ipsens Zweckverbandstheorie fand sie eine Fassung, die der technokratischen Vernunft in der EWG einen institutionellen Ankerplatz verschaffen, deren Geltungsbereich aber auch auf ,,Wissensfragen“ beschränken und wirklich ,,politische“ Fragen demokratisch legitimitierten Entscheidungsträgern vorbehalten wollte: 26 Mit seiner Zweckverbandstheorie hat Ipsen sowohl weiterreichende föderale Integrationsvorstellungen als auch die frühen Deutungen der Gemeinschaft als bloße Internationale Organisation zurückgewiesen. Das Gemeinschaftsrecht stellte sich ihm als ein tertium zwischen dem (bundes)-staatlichem Recht und dem Völkerrecht dar, das sich durch seine ,,Sachaufgaben“ konstituiert und durch deren Lösung hinlänglich legitimiert.
Nicht nur der Vollständigkeit halber ist an eine dritte, freilich gründlich diskreditierte Alternative zu erinnern. Auch sie entstammt dem Laboratorium von Weimar. Systematisch handelte es sich um eine Kritik sowohl an der Institutionalisierung ökonomischer Rationalität, wie sie dem Ordoliberalismus vor Augen stand, als auch der Institutionalisierung einer technokratischen Vernunft, wie sie der Funktionalismus befürwortete. Die Speerspitze dieser doppelseitigen Kritik war Carl Schmitt. Eine ,,gesunde Wirtschaft“, so hatte er in einer berühmten Rede im Jahre 1932 verkündet,27 benötige einen ,,starken Staat“. Dieser starke Staat war nicht der wettbewerblichen Ordnungsvorstellungen verpflichtete Staat der Ordoliberalen. Carl Schmitt insistierte auf dem Primat der Politik gegenüber einer sich ergeben ,,selbstverwaltenden“ Wirtschaft - Führerverfassung nannte sich dies wenig später. Sein Plädoyer für den ,,starken Staat“, in dem die Politik gegenüber der Wirtschaft ihre Priorität behaupten solle, hatte Carl Schmitt mit einer Polemik gegen alle technokratischen Bestrebungen verbunden, die meinen, ,,durch technische und wirtschaftliche Sachverstände nach angeblich rein sachlichen, rein technischen und rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten alle Fragen“ entscheiden zu können.28
Bei beiden Alternativen, die Schmitt kritisiert, geht es darum, spezifische Politikbereiche gegen eine paramentarisch-majoritäre Politik abzuschirmen, sei es, weil diese die Gebote allgemein-wirtschaftlicher Vernunft mißachte, um stattdessen Gruppeninteressen nachzugeben, sei es, weil sie nicht über den Sachverstand verfüge, den die technisch-wissenschaftliche Entwicklung dem Regieren abnötigt. Was bleibt möglich, wenn man, wie Carl Schmitt dies tut, beide Alternativen zurückweist und gleichzeitig die Möglichkeit der Rückkehr zu einer parlamentarisch verantworteten Politik für illusorisch erklärt? In einer rechtsvergleichenden Studie aus dem Jahre 1936 hat Schmitt sich dieser Frage gestellt.29 Seine Antwort: “Legislative Delegation“, die “vereinfachte“ Entscheidungsverfahren ermöglichen, hätten sich allenthalben durchgesetzt; der “scharfe Gegensatz zwischen Legislative und Exekutive“ sei hinfällig und alle Versuche, Delegationen in einer hinlänglich bestimmten Weise einzugrenzen, zum Scheitern verurteilt; die Stunde einer ,,Aufhebung der Trennung von Legislative und Exekutive“ habe geschlagen.30
7 Zum Begriff wiederum M. R. Lepsius, Max Weber und das Programm einer Institutionenpolitik, Berliner Journal für Soziologie 5 (1995), 327-333.
8 Die Republik der Wirtschaft. Teil I: Von der Besatzungszeit bis zur Großen Koalition, 1999, 5 ff.; vgl. zuvor K. W. Nörr, Zwischen den Mühlsteinen. Eine Privatrechtsgeschichte der Weimarer Republik, Tübingen 1988; ders., Die Leiden des Privatrechts. Kartelle in Deutschland von der Holzstoffkartellentscheidung bis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Tübingen 1994.
9 Vgl. mit vielen Belegen Ph. Manow, Modell Deutschland as an interdenominational compromise, Minda De Ginzburg Center for European Studies. Working Paper, https://wwwc.cc.coumbia.edu/sec/dlc/ciao/wps/man01; ders., Ordoliberalismus als ökonomische Ordnungstheologie, Leviathan 2001, 179-198.
10 H. Heller, Autoritärer Liberalismus, Die Neue Rundschau 44 (1933), 289-298.
11 Starker Staat und gesunde Wirtschaft. Ein Vortrag vor Wirtschaftsführern (gehalten am 23.11.1932), in: Volk und Reich, 81-94.
12 Vgl. repräsentativ und tonangebend F. Böhm, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, Tübingen 1950.
13 Eingehend mit allen Belegen: W. Mussler, Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Gemeinschaft im Wandel. Von Rom nach Maastricht, Baden-Baden 1998, 58 ff.
14 Vgl. z.B. W. Abelshauser, Die Langen Fünfziger Jahre. Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland 1949-1966, Düsseldorf 1987, 21 ff.
15 Die Republik der Wirtschaft (Fn. 9), 84.
16 BVerfGE 7, 377 (1958) - Investitionshilfe.
17 A.a.O., 103 ff.
18 Nörr, a.a.O., 84.
19 N. Stehr, Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften, Frankfurt a.M. 1994, 278 ff..
20 C. Radaelli, Technocracy in the EU, Essex/New York 1999.
21 E. Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft. Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, 2. unveränderte Auflage 1971; vgl. die Interpretation von V. Neumann, Der harte Weg zum sanften Ziel. Ernst Forsthoffs Rechts- und Staatstheorie als Paradigma konservativer Technikkritik, in A. Roßnagel (Hg.), Recht und Technik im Spannungsfeld der Kernenergiekontroverse, 1984, 88 ff.
22 Technischer Prozess und politische Ordnung, Studium Generale 22 (1969), 849 ff., 852.
23 Der Staat der Industriegesellschaft, a.a.O., 84.
24 Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation (1961) in: ders., Auf der Suche nach Wirklichkeit, Düsseldorf 1965, 442 ff., 453; vgl. I. Maus, Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus. Zur sozialen Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts, München 1976, 23 ff.; N. Stehr, a.a.O., 422 ff.
25 Vgl. M. Kaufmann, Europäische Integration und Demokratieprinzip, 1997, 300 ff.; vgl. M. Bach, Die Bürokratisierung Europas. Verwaltungseliten, Experten und politische Legitimation in Europa, 1999, 46 ff.
26 Vgl. H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, 1045; Ipsen hat an diesen Unterscheidungen stets festgehalten; vgl. Zur Exekutiv-Rechtsetzung in der EG, in P. Badura/R. Scholz (Hg.), Wege und Verfahren des Verfassungslebens. Festschrift für Peter Lerche, 1993, 425 ff.
27 Fn. 12.
28 A.a.O., 73.
29 C. Schmitt, Vergleichender Überblick über die neueste Entwicklung des Problems der gesetzgeberischen Ermächtigungen (Legislative Delegationen), ZaöRV 6 (1936), 252 ff.
30 A.a.O., 266 (Hervorhebung im Original).